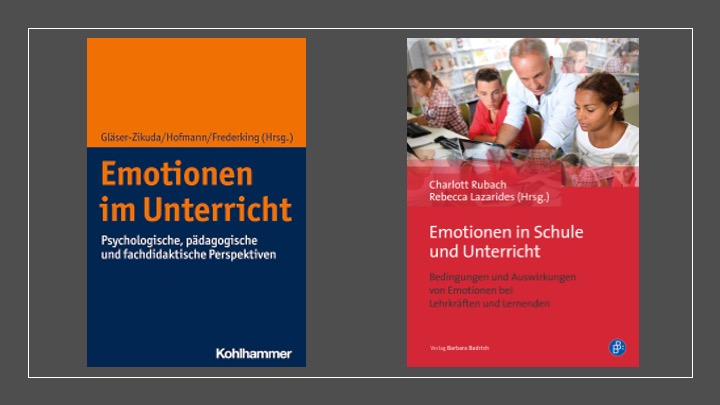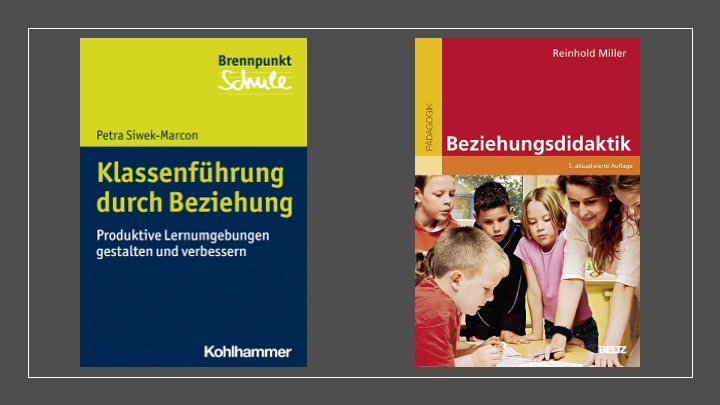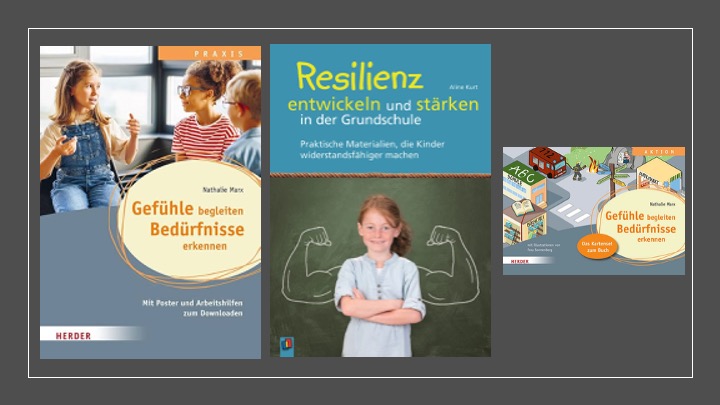Gedanken zum Umgang mit Gefühlen im Schulalltag

Autorin: Julia Strohmer
Der folgende Text behandelt drei zentrale Fragen bezüglich des Umgangs mit Gefühlen im Schulalltag. Ziel ist es einen ersten Einblick in Aspekte des Themenfelds zu geben und Denkanstöße zu erhalten. Vertiefend können unter anderem die vorgeschlagenen Bücher aus dem CDP gelesen werden oder Sie stöbern im Bibliothekskatalog. Außerdem lohnt sich ein Blick in den Katalog des Weiterbildungsangebots des IFEN.
Drei zentrale Fragen
Natürlich können ganz unterschiedliche Fragen aufgeworfen werden. Diese drei Fragen bilden aus meiner Perspektive jedoch einen guten Einstieg ins Nachdenken über Gefühle im Schulalltag:
- Wobei genau benötigen Kinder und Jugendliche Unterstützung im Umgang mit ihren Gefühlen?
- Warum ist die Schule ein Ort, an dem das seinen berechtigten Platz hat?
- Wie können wir konkret Kinder und Jugendliche beim Umgang mit ihren Gefühlen unterstützen?
Unterstützung im Umgang mit Gefühlen
Der Umgang mit Gefühlen ist stark an unterschiedliche Entwicklungsstränge der kognitiven Entwicklung gebunden, aber auch abhängig von Umwelteinflüssen. Somit können zwei Linien (die immer wieder Berührungspunkte haben) bedacht werden: der Entwicklungs- und Reifungsstand eines Kindes/ Jugendlichen und das soziale Umfeld und Erfahrungen, die in diesem Umfeld ermöglicht werden.
In der zweiten Linie liegt bereits ein Teil der Antwort auf die Frage, warum ich die Schule als Ort sehe, an dem der Umgang mit Gefühlen einen berichtigten Platz hat. Somit fokussieren wir uns nun auf die erste Linie, die uns hilft zu verstehen, wobei genau Kinder und Jugendliche Unterstützung benötigen.
Je jünger ein Mensch ist, desto mehr Regulationshilfe benötigt er. Donald W. Winnicott beschäftigt sich damit in seiner Auseinandersetzung mit der Spiegelfunktion in Interaktionen zwischen Bindungspersonen und Kindern. Auch die Idee des „Containments“ (Bion) ist hier zu nennen. Hier geht es darum, dass Erwachsene Gefühle der Kinder aufnehmen, stellvertretend bearbeiten und strukturiert (gefiltert) zurückspiegeln. Erwachsene sind somit nicht reine Projektionsfläche unerträglicher Gefühle, sondern übernehmen aktiv „Verdauungsarbeit“ und helfen somit bei der Einordnung und Verarbeitung von Emotionen.
Diese Prozesse betreffen aber keineswegs nur Kleinkinder. Gerade unter Berücksichtigung der Hirnreifung (notwendige Reifeschritte für die Umsetzung einer Impulskontrolle) und Empathieentwicklung wird deutlich, dass dies Bearbeitungsfelder bis hinein ins Jugendalter sind. Kurz und knapp: Kinder benötigen Unterstützung bei der Wahrnehmung, Einordnung und Verarbeitung von Gefühlen, da dies die Grundlage bildet, damit Regulation und Impulskontrolle greifen können. Regulationsunterstützung benötigen sie bis in Jugendalter hinein, weil Reifungsschritte teilweise erst im Grundschulalter erfolgen und Kinder und Jugendliche danach noch Entwicklungszeiten durchlaufen, damit aus der Möglichkeit, die durch Reifung gegeben ist, auch eine tatsächliche Umsetzung von Impulskontrolle im Umgang mit Gefühlen erfolgt.
Genau an diesen Gedanken schließt die Bearbeitung der zweiten Frage an.
Schule: Lern- und Bildungsraum:
Wir begegnen in der Schule Kindern und Jugendlichen, die sich individuell an einer bestimmten Stelle ihrer Entwicklung befinden. Außerdem ist zu bedenken, dass auch Erwachsene zeitlebens immer wieder neu Entwicklungsthemen des Kindes- und Jugendalters bearbeiten, jedoch unter geänderten Vorzeichen (siehe Entwicklungsmodell nach Erikson). Emotionen, Gefühle und der Umgang mit ihnen sind somit omnipräsent. Schule einschränkend als „Lernort für einen Wissenskanon“ zu definieren greift dadurch viel zu eng.
Schule ist ein Lern- und Bildungsraum. Sowohl Lernprozesse gehen über das bloße Reproduzieren von Wissensbestände hinaus, als auch erst recht Bildungsgedanken. Ein nennenswertes Konzept ist hierbei Bildung als Transformation zu denken, welches eng mit dem Namen Hans-Christoph Koller verbunden ist. Bildung ist somit vor allem ein Prozess der Veränderung von Welt- und Selbstbildern. Genau diesen Perspektivenwechsel benötigt es, wenn Kinder und Jugendliche erfahren sollen, wie unterschiedlich sozialverträglich mit Gefühlen umgegangen werden kann. Welchen Anteil ich dabei habe, welchen vielleicht andere. Perspektivenwechsel ist auch eine Grundvoraussetzung für gelebte Empathie. Empathie wiederum notwendig, um sich in einer sozialen Gruppe bewegen zu können. Schule als Ort des Zusammentreffens ist somit der ideale Ort transformatorischer Bildungsprozesse – wenn der Rahmen passt. Das meint, wenn Schule als Lern- und Bildungsraum aktiv gestaltet wird. Das beinhaltet nicht nur die Raumgestaltung, sondern vor allem die Gestaltung von Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen. Die Bindungstheorie und Ansätze der „Beziehungsdidaktik“ (Miller) und „Resonanzpädagogik“ (Rosa/Endres) geben hier Anregungen.
Inspirationen zur Umsetzung
Hier entsteht nun keine Methoden- oder Materialsammlung im Sinne von Anleitungen. Es geht darum zu verstehen, welche zentralen Elemente eine Umsetzung umfassen sollte und in welcher Art Aktivität diese beispielhaft zu finden sind. Im Anschluss finden Sie ein Video, das eine mögliche Umsetzung konkret und anschaulich zeigt.
Aktivitäten, die Kinder im Umgang mit Gefühlen unterstützen, thematisieren Gefühle vielschichtig. Es geht um:
- die Wahrnehmung von Gefühlen
- die Benennung von Gefühlen (Wortschatzarbeit)
- die Regulation von Gefühlen
- den Ausdruck von Gefühlen
- die Wahrnehmung und Benennung von Gefühlen anderer
- die Integration unterschiedlicher Gefühle in die Persönlichkeit
- den Umgang mit Gefühlen anderer
Somit gilt es zunächst zu beobachten in welchen Bereichen bestimmte Kinder mehr Unterstützung benötigen als entwicklungsbedingt anzunehmen ist. Obwohl vielleicht nur einzelne Kinder einen scheinbar erhöhten Bedarf an Begleitung haben, so können Aktivitäten rund um das Themenfeld Gefühle immer für den Klassenverband geplant werden. Alle Kinder profitieren in ein
Welche Art Aktivitäten eignen sich nun?
Phantasiereisen, Entspannungsübungen, Geschichten, Mimik- und Gestikspiele, Wortfeldspiele, Strategien zur Verlangsamung von Interaktionen (Stop-Strategien, kommunikative Kompetenzen, etc.), Notfall-Strategien (was tun, wenn ich fast explodiere?), Rollenspiele (z.B. Wie kann ich mich schützen?), usw.
Dies soll ein kleiner Leitfaden sein, wenn Sie auf der Suche nach Aktivitäten oder Methoden sind. Auch Weiterbildungen in dem Themenfeld bieten immer wieder Momente des Austauschs und Sie können von den Ideen und Erfahrungen Ihrer Kollegen und Kolleginnen profitieren und mit neuem Input in den nächsten Arbeitstag starten.
Auf der Suche nach Vertiefung?
Auf die Materialien und Bücher, die in der Bibliothek des IFEN (CDP) ausgeliehen werden können, habe ich bereits hingewiesen. Genauso auf den Weiterbildungskatalog des IFEN, der laufend interessante Weiterbildungen zu diesem Themenfeld anbietet.
Abschließend möchte ich Ihnen eine kurze Stichwortliste zur Verfügung stellen, wenn Sie tiefer in das Thema einsteigen möchten und Ihre Recherchearbeit strukturieren wollen. Selbstredend ist diese nicht erschöpfend:
- Impulskontrolle
- Empathieentwicklung
- Perspektivenwechsel als kognitive Fähigkeit
- Regulative Fähigkeiten im Kindesalter
- Resilienz
- Bindung
- Mentalisierung
Im Text erwähnte Literaur
- Bion, Wilfred R. (1997). Lernen durch Erfahrung. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1997.
- Erikson, Erik H. (1988): Der vollständige Lebenszyklus. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft: Frankfurt a.M. 1988.
- Erikson, E. H. (1973): Identität und Lebenszyklus. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft: Frankfurt a.M. (1973).
- Koller, Hans-Christoph (2023). Bildung anders denken. Einführung in die Theorie transformatorischer Bildungsprozesse. Kohlhammer: Stuttgart 2023, 3. aktualisierte Auflage.
- Miller, Reinhold (2011). Beziehungsdidaktik. Beltz: Weinheim, 5. überarbeitete Auflage 2011.
- Rosa, Hartmut/ Endres, Wolfgang (2016). Resonanzpädagogik: wenn es im Klassenzimmer knistert. Beltz: Weinheim, 2. Auflage 2016.
- Winnicott, Donald W. (1979): Vom Spiel zur Kreativität. Klett-Cotta: Stuttgart 1979.
Pädagogische Hilfsmittel
Zum Abschluss